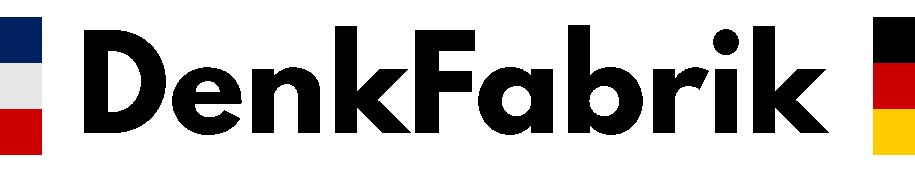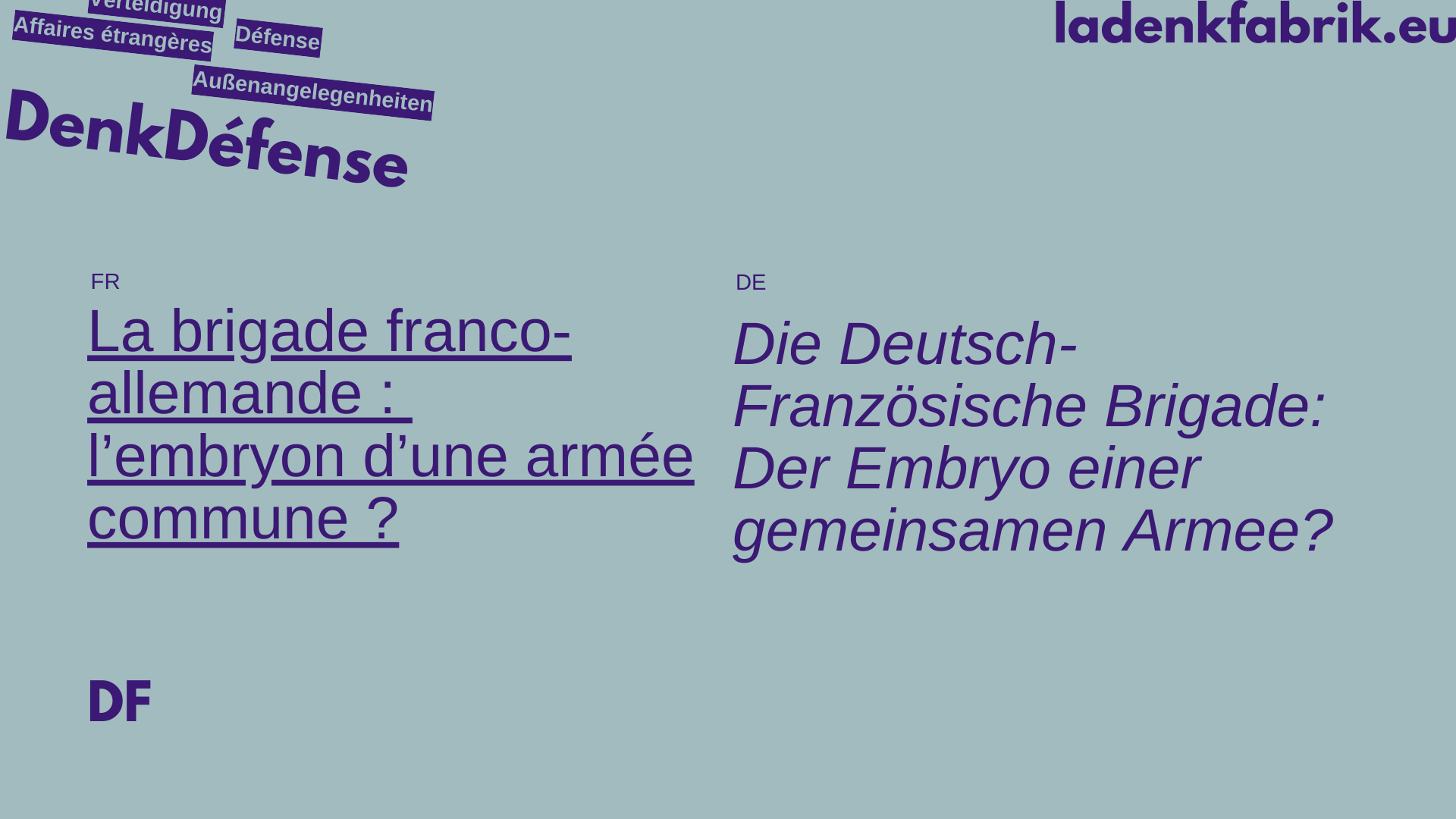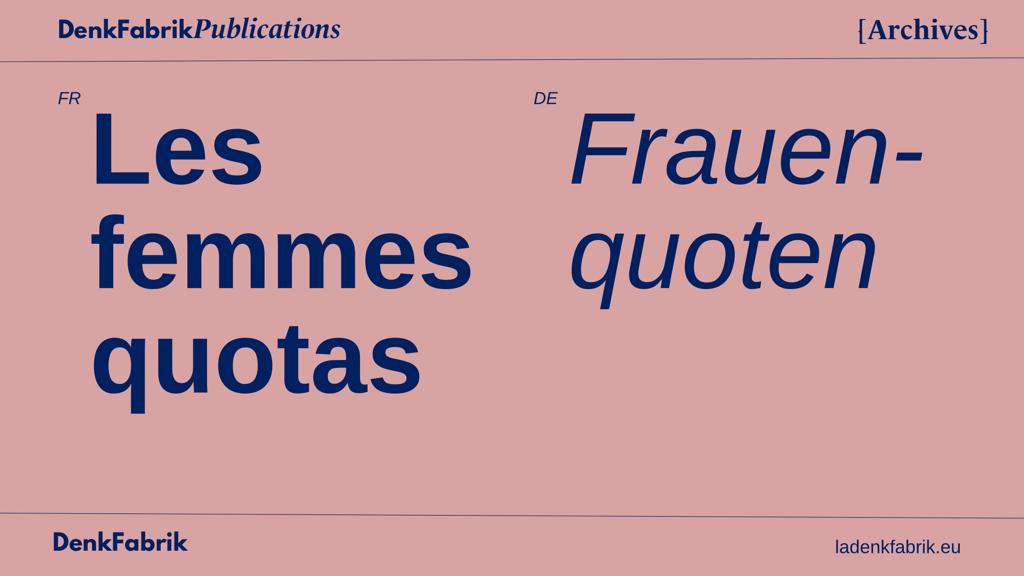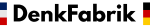Eine Geschichte großer Gesten
Die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen ist geprägt von Blut, Hass und Kriegen. Vom Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 über den Ersten Weltkrieg bis hin zur Katastrophe von 1939 bis 1945 standen sich die beiden Nationen in einer hereditären Feindschaft gegenüber. Millionen Tote, zerstörte Länder, tiefes Misstrauen: Kaum zwei europäische Staaten haben eine derart konfliktreiche Beziehungsgeschichte. Und dennoch: Nur wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg begannen Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland einen Prozess der Annäherung, der in der Weltgeschichte seinesgleichen sucht.
Es war der französische Außenminister Robert Schuman, der 1950 den Grundstein für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) legte – ein radikaler Vorschlag: die wirtschaftlich und sicherheitspolitisch bedeutendsten Ressourcen beider Staaten gemeinsam zu verwalten. So sollte ein neuer Krieg zwischen Frankreich und Deutschland "nicht nur undenkbar, sondern materiell unmöglich" gemacht werden. Dieser Plan war keine romantische Vision, sondern eine rationale Entscheidung aus der Notwendigkeit heraus. Der Kalte Krieg zeichnete sich bereits ab, und die USA drängten auf europäische Einigung als Bollwerk gegen den Kommunismus.
1954 scheiterte die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) zwar am französischen Parlament, doch die Richtung war klar: Aus ehemaligen Feinden sollten Partner werden. Mit den Römischen Verträgen 1957 und schließlich dem Élysée-Vertrag von 1963 wurde die deutsch-französische Zusammenarbeit zur Grundlage der Europäischen Einigung. Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, Symbolfiguren der Versöhnung, inszenierten eine neue Ära, die auf Kooperation statt Konfrontation beruhte.
Dieser nüchterne Blick auf ihre Entstehungsgeschichte legt einen unbequemen Verdacht nahe: Die deutsch-französische Freundschaft war keine Liebesheirat, sondern eine arrangierte Ehe – geboren aus den Ruinen zweier Weltkriege, aus der Notwendigkeit des Friedens und dem Zwang, Europas Zukunft zu sichern. Was 1945 als „Nie wieder Krieg!“ begann, wurde in den 1950er Jahren zur pragmatischen Kooperation. Aus der Realpolitik der Versöhnung folgte die Notwendigkeit funktionaler Integration. Mit dem Schuman-Plan für die Montanunion und dem Versuch, eine gemeinsame europäische Verteidigung aufzubauen, war die Marschrichtung klar: Frieden durch Integration. Die Freundschaft war das Mittel, nicht das Ziel.
Auch dadurch war die deutsch-französische "Freundschaft" von Beginn an ambivalent. Der Élysée-Vertrag wurde in Frankreich als Schritt zur Souveränität gefeiert, in Deutschland aber durch eine begleitende Bundestagsentschließung explizit im Rahmen der transatlantischen Partnerschaft interpretiert. So entstand ein Spannungsverhältnis zwischen europäischer Integration und nationaler Strategie, das bis heute anhält.
Wenn Rituale zur Inszenierung werden
In der Praxis entwickelte sich ein dichtes Netz bilateraler Beziehungen: Gemeinsame Ministerrats-Sitzungen, intergouvernementale Kommissionen, Austauschprogramme wie "Voltaire" oder "Erasmus+", das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW), die Deutsch-Französische Hochschule, Medienkooperationen wie ARTE, sowie zahllose Städtepartnerschaften. Ihre Wirksamkeit lässt sich empirisch per Teilnehmendenstatistiken (z. B. 180.000 DFJW-Stipendiaten seit 1963) messen, doch die tiefergehende soziale Kohäsion bleibt schwer quantifizierbar. Die symbolische Verdichtung gipfelte oft in großen Gesten: etwa als Helmut Kohl und François Mitterrand 1984 händchenhaltend in Verdun der Gefallenen gedachten oder 2019 Emmanuel Macron und Angela Merkel den Aachener Vertrag unterschrieben.
Heute ist vieles davon Ritual geworden. Schüleraustauschprogramme, gemeinsame Kabinettssitzungen, Städtepartnerschaften – alles sinnvolle Instrumente, doch allzu oft wirken sie wie top-down verordnete Inszenierungen. Es fehlt nicht an Gesten, aber an Glaubwürdigkeit. Nicht an Struktur, sondern an Seele. Die Beziehung zwischen Berlin und Paris ist durchdrungen von Symbolik, aber mitunter erschreckend leer, wenn es um konkrete Zusammenarbeit geht. Vor allem in der jungen Generation verliert die deutsch-französische Achse an Relevanz. Die Sprachkompetenz in der jeweiligen Nachbarsprache geht zurück. Nur etwa 15 % der deutschen Schüler lernen heute noch Französisch. In Frankreich ist Deutsch eine Randerscheinung geworden. Der gegenseitige Handel stagniert, der kulturelle Austausch bleibt oberflächlich.
La connaissance de l’autre s’effrite : politique, société, histoire – tout cela devient flou. Et les tensions fondamentales n’ont pas disparu, elles ont simplement changé de forme. En matière économique, l’austérité allemande s’oppose à la volonté d’investissement française. Sur l’énergie, on se divise autour du nucléaire et des objectifs climatiques. Tandis que l’Allemagne se voit comme une puissance régulatrice au cœur de l’UE, la France revendique une autonomie stratégique – notamment face à la Chine, aux États-Unis, ou dans le domaine de la défense. Le grand projet d’une défense européenne commune reste paralysé par des égoïsmes nationaux : l’Allemagne hésite, la France pousse.
Das eigentliche Problem ist jedoch tieferliegend: Die deutsch-französische Beziehung wird nach wie vor zu stark von politischen Eliten verwaltet – und zu wenig von den Gesellschaften gelebt. Es ist bequem, die Freundschaft in Verträgen zu verankern. Doch Institutionen ersetzen keine Emotionen. Genau die braucht es aber, wenn eine Partnerschaft auch noch nach Generationen von Dauer sein soll.
Kein Europa ohne deutsch-französischen Schulterschluss
In Wahrheit ist der Zusammenhalt Europas nach innen heute genauso gefährdet wie seine Position nach außen. Der Krieg in der Ukraine hat die geopolitischen Karten neu gemischt. Osteuropa verlangt zu Recht mehr Mitsprache. Die USA richten ihren Blick zunehmend auf den Pazifik. In dieser Lage kann es sich Europa nicht leisten, dass die deutsch-französische Achse ins Wanken gerät. Im Gegenteil: Sie muss stärker, radikaler, visionärer werden.
Denn auch das ist Realität: Ohne ein geeintes Zentrum wird die EU auseinanderdriften. Dafür wird eine engere Abstimmung mit den osteuropäischen Staaten Europas unerlässlich sein, die in vielen Politikbereichen fundamental andere Ansichten verfolgen und anderen geopolitischen Zwängen ausgesetzt sind. Doch bevor man diese Herausforderung ernsthaft erörtern kann, muss man konstatieren: Der Zusammenhalt über den Rhein hinweg ist Voraussetzung für jede ernsthafte Partnerschaft mit dem Osten Europas. Wer über EU-Erweiterung spricht, darf über EU-Vertiefung nicht schweigen. Und die beginnt bei denen, die Europa einst erfunden haben.
Diese Differenzen sind nicht nur technische Probleme, sondern Ausdruck tieferliegender, historisch gewachsener kultureller und politischer Identitäten. Frankreich versteht sich als strategische Nation mit globalem Anspruch, Deutschland als pragmatische Macht in einem regelbasierten Ordnungsrahmen. Diese unterschiedlichen Selbstbilder kollidieren immer wieder, etwa beim Thema Atomwaffen, Rüstungsexporte oder europäische Industriepolitik.
Ein allgemeiner Hinweis auf die Notwendigkeit einer vollendeter Kapitalmarktunion, besserer Wirtschaftskooperation und engerer politischer Abstimmung erübrigt sich. Wenn der deutsche Bundeskanzler es ernst meint mit Europa, dann braucht es mehr als diplomatische Floskeln. Eine mutige Agenda, welche die deutsch-französische Beziehung weiterentwickelt statt verwaltet, könnte konkret folgende Vorstöße umfassen:
Sechs Vorschläge für eine echte Wiederbelebung
- Französisch als Pflichtsprache in der ersten Sekundarstufe
Verständigung entsteht echte Nähe. Man kann sie zwar nicht forcieren, aber begünstigen. Französisch muss wieder fest in den deutschen Lehrplänen verankert werden – verpflichtend und gefördert. Und umgekehrt sollte Deutsch auch in Frankreich wieder stärker gefördert werden. - Akzeptanz diplomatischer Polyvalenz
Die außenpolitischen Divergenzen innerhalb der EU und insbesondere zwischen Frankreich sowie Deutschland sind vielfach als Schwäche ausgelegt worden. Dabei ist das vielfach herbeigesehnte „Sprechen mit einer Stimme“ in Kommuniqués ein rein deklarativer Akt. Stattdessen könnte man die Möglichkeit verschiedene Positionen einzunehmen, unterschiedliche diplomatische Kanäle zu nutzen und meinungsvielfältig zu argumentieren sogar als Stärke auslegen. Zumindest solange sie einem gemeinsamen Ziel untergeordnet ist, kann eine solche komplementäre Außenpolitik die Beziehung stärken – und Signalwirkung entfalten für die ganze EU. - Neuer Anlauf für eine gemeinsame Rüstungsindustrie
Während bilaterale Rüstungsprojekte historisch notwendig waren, um Kriegspotenziale abzubauen und – in späterer Zeit – um der Konkurrenz nationaler Projekte vorzubeugen, sind sie heutzutage nicht mehr zukunftsfähig. Partikularinteressen, Lobbyismus verschiedener beteiligter Unternehmen und Logistikprobleme aufgrund der politisch gewollten Einbindung anderer Staaten blockieren eine effiziente Industrie. Europa braucht eine einheitliche Armee mit gemeinsamen Standards, Ausbildung, Markt und Strategie. Deutschland und Frankreich müssen sie anführen. Dabei können sie sich auf die Erfahrungen aus der Deutsch-Französische Brigade stützen. Industriepolitisch bedeutet das: standardisierte Zulassungsnormen (STANAG-ähnliche EU-Standards), ein gemeinsames Programmmanagement für Großprojekte und eine europaweit genutzte Plattform für Interoperabilität, die sowohl bemannte als auch unbemannte Systeme zusammenführt. - Realismus in der Nukleardoktrin
Die vorgeschlagene Ausweitung des französischen Atomwaffenschirms ist nur eine (vor allem finanziell motivierte) Scheinlösung für das nukleare Deterrence-Problem. Die aktuellen Kapazitäten reichen nicht für realistische Abschreckung aus. Vorzugsweise wäre ein neuer europäischer Abwehrschirm, der sich mit bewältigbaren Kosten aus den Restbeständern der verbliebenen europäischen Atommächte und Neuentwicklungen bilden. Praktisch würde das bedeuten, nationale Trägersysteme bleiben formal in den Händen der jeweiligen Staaten, Entscheidungen über Einsatzschwellen, Lagerungssicherheit und Krisenprozeduren unterlägen hingegen einem multilateralen Gremium mit parlamentarischer Aufsicht auf Basis eines Abkommens über Lastenteilung, geteilte Sicherungs- und Frühwarninfrastrukturen sowie gemeinsame technische Modernisierungen. Dezentral stationiert und europäisch verwaltet würde dies zudem die Zweitschlagfähigkeit stärken, wobei hierfür eine tieferliegende Einigung über Verteidigungskompetenzen vorangehen müsste. - Europäischer Forschungsfonds
Auf der Grundlage der Ansätze zur digitalen Gestaltung braucht es einen gezielten, operativen Forschungsfonds, der tieftechnologische Entwicklungslinien mit industrieller Umsetzung verbindet. Der Fonds arbeitet mit regionalen Kompetenzzentren zusammen — Forschungscampusse in technologisch starken Regionen koppeln Universitätsforschung, staatliche Förderung und Risikokapital. Förderkriterien zielen auf kritische Technologien wie künstliche Intelligenz, Quantenkommunikation, sichere Cloud-Infrastrukturen und grüne Energiespeicher; Intellectual-Property-Mechanismen werden so gestaltet, dass europäische Unternehmen von Public-Funded Forschung nachhaltig profitieren können. Offene Standards, verbindliche Interoperabilität und eine starke Kopplung an Ausgründungen stellen sicher, dass Forschung in Produkte und Arbeitsplätze überführt wird. - Abbau von nicht-tarifären Handelshemmnissen
Le marché intérieur européen souffre encore d’obstacles pratiques qui pourraient être levés par des solutions techniques et administratives claires. Il faut créer des « One-Stop-Shops » (guichets uniques numériques) pour la création d’entreprises transfrontalières, des procédures automatiques de reconnaissance des qualifications professionnelles via des plateformes d’identité interopérables, ainsi que des règles harmonisées de passation de marchés pour les infrastructures critiques. Les outils de soutien public – banques de développement, agences d’innovation – devraient regrouper leurs programmes pour des projets transfrontaliers et faciliter l’accès au capital à travers des lignes de crédit communes. Du côté administratif, un système bilatéral d’ombudsman pour les litiges commerciaux permettrait de trancher rapidement. Ces réformes opérationnelles stimuleraient l’investissement, réduiraient les délais de mise sur le marché et instaureraient la confiance, notamment parmi les PME et les start-ups. Mieux encore : testées dans le cadre bilatéral, elles pourraient devenir le moteur de réformes européennes plus larges.
Wenn die EU immer weiter der Versuchung erliegt, ihre Legitimation aus der Vergangenheit zu beziehen, statt einen Anspruch auf Mitgestaltung der Zukunft zu formulieren, läuft sie tatsächlich Gefahr zu sterben. Soll dieses Europa Bestand haben, dann reicht es nicht, dass sich Kanzler und Präsident gut verstehen. Dann reicht es nicht, dass Kinder Fähnchen schwenken und Bürgermeister Partnerschaften pflegen. Dann muss aus der Partnerschaft von Staaten endlich eine Freundschaft der Völker werden – durch Sprache, Austausch, geteilte Verantwortung und gemeinsame Visionen.
Die deutsch-französische Freundschaft ist keine historische Selbstverständlichkeit. Sie ist eine künstliche, historisch anomale Erfindung – und als solche muss sie gepflegt, verbessert und manchmal auch neugedacht werden. Nicht als Ritual, sondern als politische Tat. Nicht als Pflichtübung, sondern als leidenschaftliches Bekenntnis zu einem Europa, das mehr ist als ein Markt. Das sich nicht nur auf die Vergangenheit stützt. Ein Europa, das auch noch Zukunft sein will.