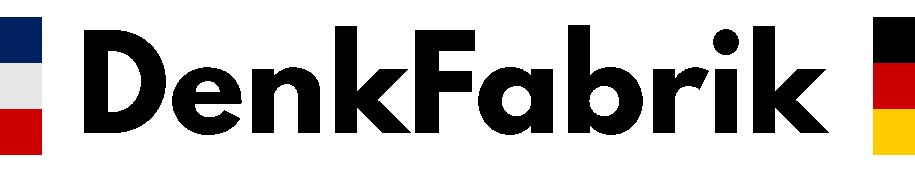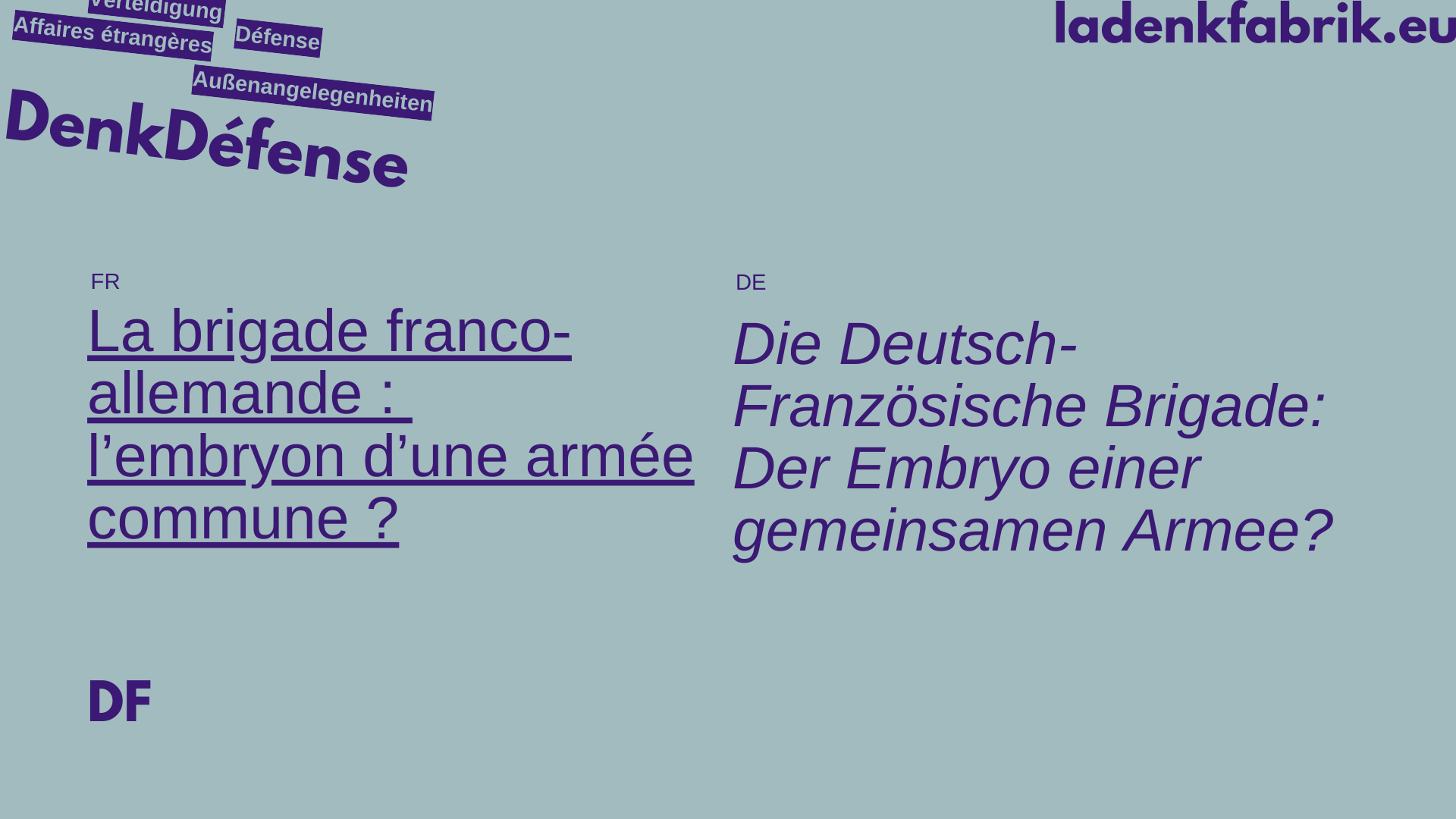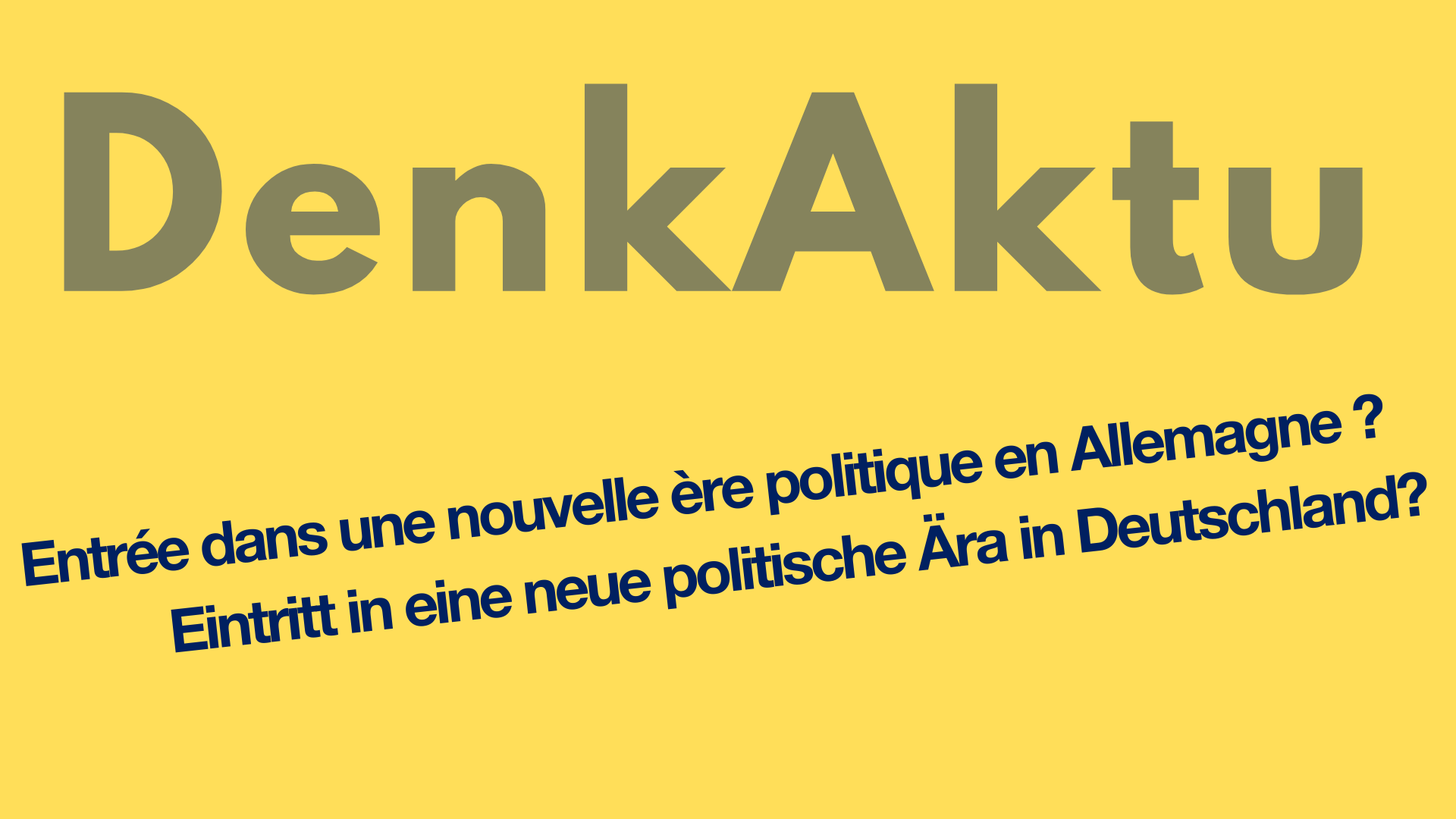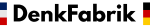Es ist stets eine Herausforderung, den Wendepunkt einer Weltordnung zur nächsten zu bestimmen. Für die jungen Generationen in Frankreich und Deutschland könnte dieser Moment die Rückkehr des Krieges in Europa, der Rücktritt Angela Merkels aus der deutschen Kanzlerschaft oder sogar die Auflösung der französischen Nationalversammlung durch Emmanuel Macron infolge der Europawahlen gewesen sein. All diese Ereignisse werden als Symptome einer neuen politischen Ära betrachtet oder als Elemente unter vielen, die die Etablierung eines tiefgreifenden Wandels markieren oder beschleunigen, der seit mehreren Jahren in Europa und weltweit spürbar ist. Der Austritt der FDP (Freie Demokratische Partei) aus der Regierungskoalition in Deutschland, der zur Auflösung des Bundestags und zur Ansetzung vorgezogener Neuwahlen führte, stellte eine weitere Zäsur in der europäischen Geopolitik dar. Diese Ankündigung erfolgte am selben Tag, an dem Donald Trump zum zweiten Mal zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde.
Es bleibt schwierig zu bestimmen, welches Ereignis den Übergang von der alten zur neuen Welt einleitete; ebenso komplex und subjektiv ist die Unterscheidung zwischen Symptomen und Konsequenzen. Fest steht jedoch, dass die staatlichen Strukturen und der europäische Wiederaufbau nahezu direkt aus der Nachkriegszeit und den daraus resultierenden Traumata hervorgegangen sind – die Demilitarisierung Deutschlands war dabei ein zentrales Element.
Frankreich und Deutschland sehen sich seit mehreren Jahren mit einem starken Anstieg extremistischer Strömungen, wachsendem Euroskeptizismus und den Risiken des Klimawandels konfrontiert. Diese Herausforderungen führten jedoch nicht zu einem so radikalen Politikwechsel wie die Infragestellung des transatlantischen Bündnisses durch die zweite Trump-Administration. Diese Regierung, die deutlich radikaler ist als die Regierung zwischen 2016 und 2020, stellt die seit über einem halben Jahrhundert bestehenden Beziehungen zwischen den USA und dem alten Kontinent infrage. Dies wird unmissverständlich durch ein Gesetz belegt, das am Dienstag, dem 18. März 2025, im Deutschen Bundestag verabschiedet wurde. An diesem Tag schlug das Parlament ein neues Kapitel in seiner Geschichte auf – oder schloss ein altes ab.
Deutschland, dessen (Wieder-)Aufbau nach dem Krieg unter der Aufsicht der Alliierten erfolgte, hat die Lehren aus seiner Vergangenheit in seiner Verfassung und seiner institutionellen Struktur verankert. Die Weigerung, sich als Militärmacht zu positionieren, und die wirtschaftliche Sparsamkeit sind dafür beispielhaft. Die moderne deutsche Haushaltsdisziplin hat ihre Wurzeln im Trauma der Hyperinflation der 1920er Jahre, als die Währung ihren Wert verlor und man eine Schubkarre voller Geldscheine brauchte, um ein Brot zu kaufen. Diese Disziplin ist auch Teil einer umfassenderen Kultur der Sparsamkeit, die manche auf die lutherische Reformation zurückführen.
Ihre Umsetzung fand Ausdruck im Grundgesetz, insbesondere durch die „Schwarze Null“, die die Verschuldung der Länder auf 0,35 % des BIP begrenzt und als Garantie für wirtschaftliche Stabilität galt. Für die Gründungsväter der Bundesrepublik Deutschland war eine stabile Wirtschaft ein erster Schutzwall gegen Inflation und politische Instabilität – Phänomene, die in der Geschichte den Weg für Populismus, Nationalismus und politische Verzweiflung geebnet haben. Doch der rasante Aufstieg der rechtsextremen AfD (Alternative für Deutschland) zeigt, dass diese Sparpolitik Deutschland nicht gerettet hat.
Diese Umgestaltung der politischen Landschaft geht einher mit großer Unsicherheit gegenüber den USA, die bislang die militärische Sicherheit der Bundesrepublik gewährleistet hatten. Wenige Tage vor dem Amtsantritt des neuen Parlaments beeilten sich die Abgeordneten des „alten“ Bundestags, eine Revision des Grundgesetzes zu verabschieden, um den Herausforderungen dieser Veränderungen zu begegnen.
Diese Reform, die eine Lockerung der durch die „Schwarze Null“ auferlegten Schuldenbremse vorsieht, war die erste Maßnahme von Friedrich Merz, dem neuen Bundeskanzler, der es zwar schaffte, eine Maßnahme vor seinem Amtsantritt durchzusetzen, aber als erster Kanzler in die Geschichte eingehen wird, der bei der ersten Abstimmung im Bundestag nicht gewählt wurde.
Merz ermöglichte Investitionen in Höhe von mehreren hundert Milliarden Euro durch die Schaffung eines Sonderfonds von 500 Milliarden Euro, der über Kredite in die Infrastruktur investiert werden soll. Dieser deutsche Schuldenplan markiert den Beginn einer neuen Ära, in der Deutschland sich entschlossen hat, seine Verteidigung selbst in die Hand zu nehmen und sich aus der Abhängigkeit von seinem amerikanischen Verbündeten zu befreien. Diese Entscheidung wurde jedoch überstürzt getroffen, da jede Verfassungsänderung die Zustimmung von zwei Dritteln des Parlaments erfordert – eine Mehrheit, die nur mit dem alten Bundestag erreicht werden konnte. Die Ergebnisse der AfD bei den Wahlen am 23. Februar verschafften ihr eine noch nie dagewesene Opposition Mehrheit. Diese neue Konfiguration des Bundestags ist ein weiteres Zeichen für die politischen Veränderungen, die Deutschland durchlebt und die es weiter von seiner ideologischen und institutionellen Nachkriegsordnung entfernen. Eine Entwicklung, die durch den Fehlstart von Friedrich Merz gekennzeichnet ist, der die Zersplitterung des Bundestags zu spüren bekam, in dem die traditionellen Regierungsparteien CDU und SPD nicht mehr allein für einen reibungslosen Parlamentsbetrieb sorgen können und einer lauten und mächtigen Opposition gegenüberstehen.
So wurden innerhalb weniger Monate die seit Jahren absehbaren Veränderungen Realität. Ob es sich um das Ende der nachkriegszeitlichen bipolaren politischen Ordnung, die Abkehr der Haushaltsorthodoxie oder die militärische Neuorientierung handelt – Deutschland stellt sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, indem es mit den Rahmenbedingungen der Nachkriegszeit bricht.
Lucille Niro